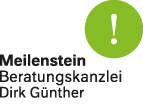Hallo an alle Interessierte des Verbände-Talks!
Einige Jahre habe ich den Verbände-Talk parallel neben meiner beruflichen Tätigkeit als Verbände-Berater betrieben.
Aufgrund der fortgesetzt hohen Nachfrage nach meiner Beratungstätigkeit fehlen mir die Ressourcen, das Blog mit dem von mir mit dem Schreiben verbundenen Anspruch regelmäßig weiter zu führen.
Ich mache daher eine – nunmehr offizielle – Pause, die sicherlich noch bis zum Frühjahr 2019 andauern wird.
Mit der Bitte um Verständnis und
herzlichen Grüßen,
Dirk Günther